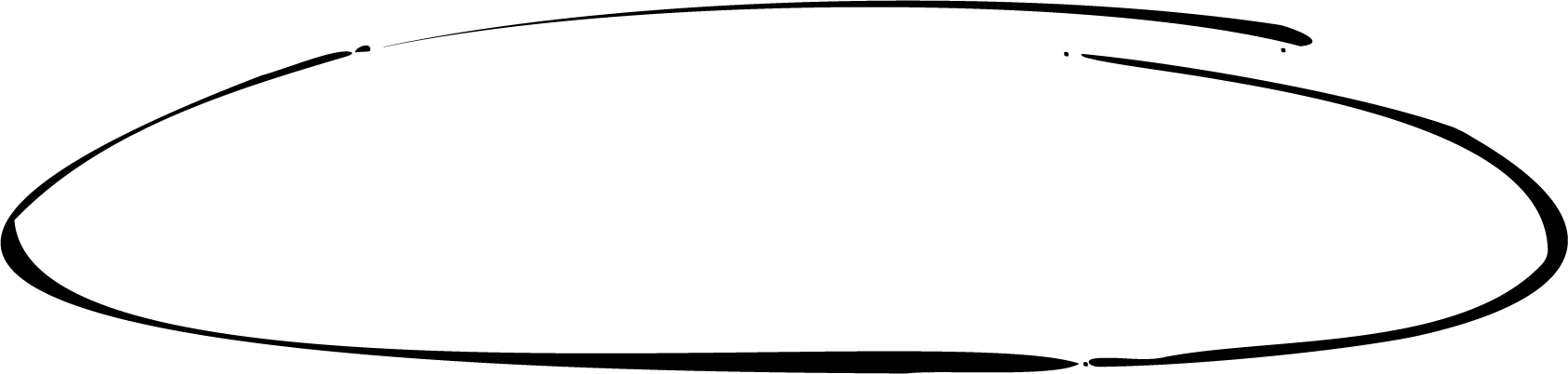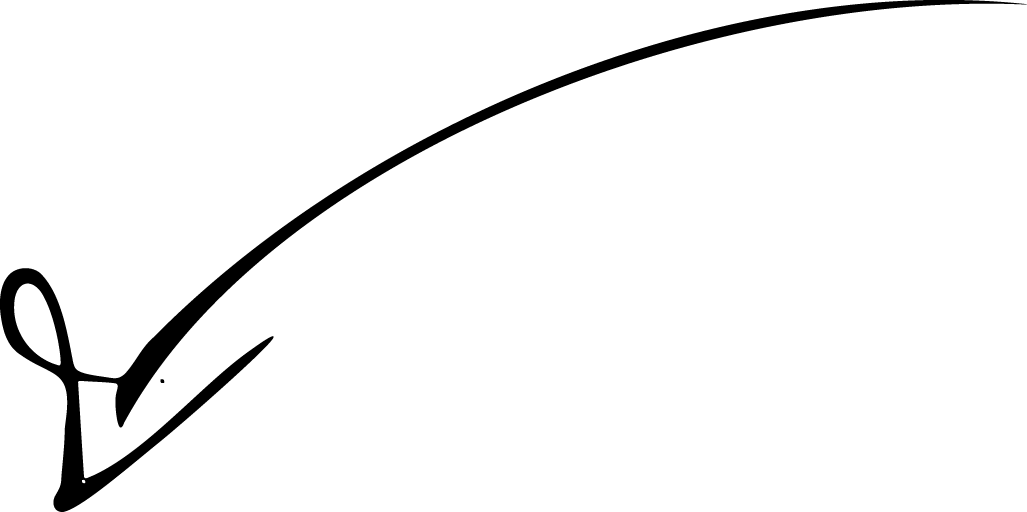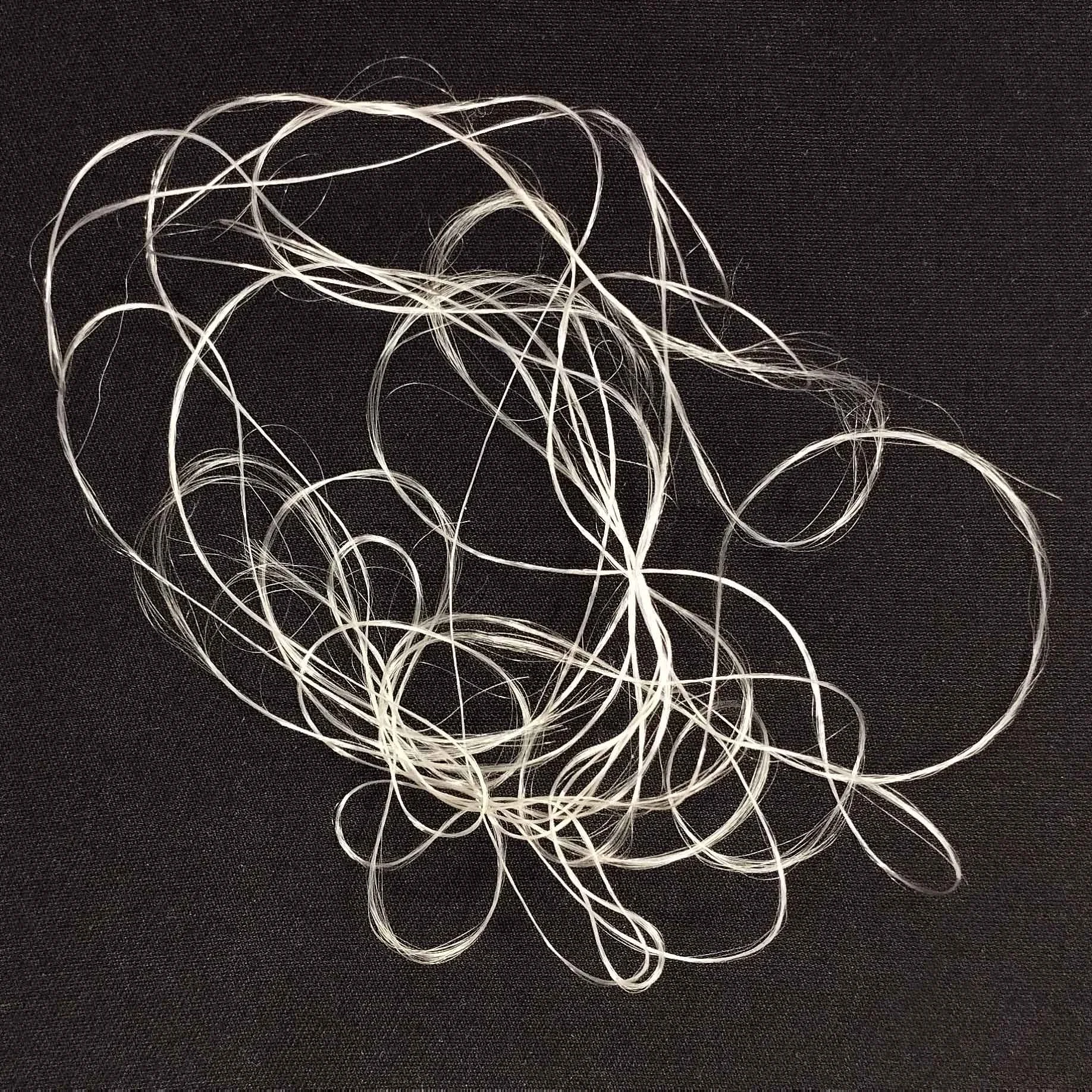Faserlexikon
Textilfasern:
Die Basis von Kleidung
Jedes Gewebe, jedes Gestrick – im Grunde jedes Textilprodukt, das wir tragen oder nutzen, besteht aus Fasern. Diese kleinen Bausteine sind die Basis von allem. Sie sind die Helden hinter den Kulissen, die über die Haptik, Langlebigkeit und sogar die Umweltbilanz unserer Kleidung entscheiden.
Um euch einen Überblick zu geben, lassen sich Textilfasern in drei Hauptkategorien unterteilen: Naturfasern, die direkt aus der Natur stammen, und Chemiefasern, die künstlich hergestellt werden. Die Chemiefasern selbst können wiederum in synthetische Fasern (meist auf Erdölbasis) und sogenannte Chemiefasern auf Pflanzenbasis (oft auch "regenerierte Fasern" genannt) gegliedert werden.
Zu Anfang dieser Seite geben wir euch einen ersten, umfassenden Überblick über die wichtigsten Textilfasern. Im Anschluss werden wir uns in den folgenden Abschnitten und Beiträgen die am häufigsten verwendeten Fasern genauer ansehen, ihre einzigartigen Eigenschaften beleuchten und ihre ökologischen Auswirkungen kritisch unter die Lupe nehmen.
Lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Fasern eintauchen!
Faserbezeichnungen und Abkürzungen
Naturfasern
Pflanzenfasern
Samenfaser
Baumwolle | CO: Fasern der Baumwollpflanze.
Kapok | KP: Fasern des Kapokbaumes.
Bast & Hartfaser
Abaca / Manila | AB: Bananenfaser, sehr Robust. Verwendung in Seilen, Netzen. oder Verarbeitung zu Zellulose.
Halfagras / Espartogras | AL: Verwendung für Seile und Flechtarbeiten.
Kokos | CC: gesponnene Faser aus der Umhüllung der Kokosnussschale.
Fique | FI: Faser aus den Blättern von Pflanzen der Gattung Furcraea.
Leinen | LI: Bastfaser gewonnen aus der Flachspflanze.
Hanf | HA: Faser aus dem Bast der Hanfpflanze.
Henequen | HE: Faser aus Agave fourcroydes /Henequen Agave. Faser ist feiner und kürzer als Sisal.
Urena | JR: Faser aus Malvengewächs.
Jute | JU: Faser aus tropischen und subtropischen Malvengewächs.
Kenaf | KE: Faser aus subtropischem Malvengewächs.
Phormium | NF: Faser aus Neuseeländer Flachs.
Ramie | RA: ostasiatische Brennnesselpflanze, aufwändige Verarbeitung zur Faser.
Sisal | SI: Faser aus der Agave sisalana /Sisal-Agave.
Sunn | SN: ‘Indischer Hanf’
Tierische Fasern
Wolle & Feines Tierhaar
Angora | WA: Haare des Angorakaninchen.
Vikunja | WG: Fasern aus dem Fell dieser Kamelart.
Kamel | WK: Flaumhaar der Kamele.
Lama | WL: Fasern aus dem Fell dieser Kamelart.
Mohair | WM: Haare der Angora-/Mohairziege.
Kanin | WN: Fasern aus dem Fell des Kaninchens.
Reißwolle | WO: Herstellung aus Alttextilien, Recyclingprodukt.
Alpaka | WP: Fasern aus dem Fell dieser Kamelart.
Kashmir | WS: Flaumhaar der Kaschmirziege.
Guanako | WU: Fasern aus dem Fell dieser Kamelart.
Schurwolle | WV: Schaf- oder Ziegenwolle von lebenden Tieren.
Yak | WZ: Faser aus dem Fell des Yak.
Pygora: Kreuzung zwischen Angoraziege und afrikanischer Pygmy Ziege.
Cashgora: Kreuzung zwischen Angora- und Kaschmirziege.
Quivit: Unterwolle des Moschusochsen.
Cervelt: Unterhaar des Neuseeländischen Rothirschs; sehr selten.
Chiengorra: Hundehaar.
Grobes Tierhaar
Rinderhaar | HR
Roßhaar | HS
Ziegenhaar | HZ
Seidenfaser
Maulbeerseide | SE: Zuchtseide aus den Kokons des Maulbeerspinners.
Tussahseide | ST: Wildseide aus den Kokons der wildlebenden Eichenseidenspinners.
Mugaseide: Wildseide vom Mugaseidenspinner.
Eriaseide: Zuchtseide vom Götterbaum-Spinner.
Anapheseide / Nesterseide: vom afrikanischen Falter Anaphe panda, Anaphe moloneyi.
Yamamaiseide / Tensanseide: Wildseide vom japanischen Eichenspinner.
Ahimsaseide: aus Indien stammende Seide von Eri- und Tussah-Mottenkokons.
Fagaraseide: Wildseide vom Atlasspinner.
Circulaseide: Wildseide vom Falter Circula trifenestrata.
Byssus: Faser aus den Haftfäden von Edler Steckmuschel, verschiedenen Miesmuschelarten und Wandermuschel (historisch relevant, aktuell nicht mehr verwendet)
Synthetsche Fasern
Chemiefasern aus synthetischen Polymeren (Erdölbasis)
Aramid | AR: flammbeständige Fasern, sehr robust z.B. Schutzwesten.
Polyvinylchlorid | CLF: flammbeständig, wasserabweisend.
Elastodien | ED: Sehr dehnbare Fäden aus Polyisopren.
Elastan | EL: sehr elastische Fäden aus Polyurethan.
Fluoror | PTFE: Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, Anti-Haft- und reibungsvermindernde Eigenschaften (Bsp. Teflon).
Modacryl | MAC: selbstverlöschend, z.B. Schutzbekleidung, Vorhänge, Auslegewaren.
Polyamid | PA: thermoplastischer Kunststoff, sehr hohe Festigkeit, sehr dehnbar.
Polyacryl | PAN: wollähnlicher Griff.
Polyethylen | PE: nicht reißfest, z.B. Vliesstoffe.
Polyester | PES: reiß- & scheuerfest, kaum Wasseraufnahme.
Polypropylen | PP: reiß- & scheuerfest, keine Wasseraufnahme z. B. Mikrofasern.
Polyvinylalkohol | PVAL: wasserlöslich z. B. als herauslösbare Stütz- & Hilfsfäden.
Chemiefasern auf Pflanzenbasis
Alginat | ALG: aus Nassspinnverfahren aus Natriumalginat erzeugt werden
Acetat | CA: Zellulose aus Holz (Buchenholz) + Essigsäure, Seidenähnlich
Lyocell | CLY: Zellulose aus Holz, Lenzing AG: TENCEL, REFIBRA
Modal | CMD: Zellulose aus Holz (überwiegend Buche) höherer Polymerisationsgrad als Viskose
Triacetat | CTA
Cupro | CUP: Zellulose aus kurzen Baumwollfaser. Kupferoxid-Ammoniak-Verfahren (Cuoxam-Verfahren).
Gummi | LA
Innovative Materialien – vegane & nicht synthetische Lederalternativen:
Ananasfasern (Piñatex®)
Bananenfasern
Pilz/Myzel (Muskin™, Mylo™)
Kombucha
Kork
Teakblätter
Apfelfasern (AppleSkin™)
Kaktusfaser (Desserto®)
Weinleder (Vegea™)
Papierleder (Washable Paper)
Leder:
Rinderleder: Nappa Ecrase, Boxcalf, Frösen, Goldchrom, Mastbox, Rindbox, Vechette
Ziegenleder: Chevreau, Maroquin Saffian, Gasometer
Schafleder: Chevretten, Mouton, Skiver, Waschleder
Schweineleder: Porc, Peccary
Pferdeleder: Cordovan
Gämse: Chamois
Reptilienleder: aus Krokodil, Schlange
Fischleder: aus Aal, Dorsch, Rochen, Hai
Känguruleder
Straußenleder
Elefantenleder
Pflanzenfasern bilden das Fundament vieler Textilien. Sie sind die ältesten Fasern, die der Mensch nutzt, und stammen, wie der Name schon sagt, aus der Pflanzenwelt. Je nachdem, aus welchem Teil der Pflanze sie gewonnen werden, unterscheidet man zwischen Samengewinnungsfasern, wie zum Beispiel Baumwolle, und Bastfasern, die aus dem Stängel stammen, wie Leinen oder Hanf.
Baumwolle: Ein globaler Gigant
Baumwolle (CO) ist eine Samenfaser, die seit über 7.000 Jahren angebaut wird. Ursprünglich aus Mexiko, Peru und Indien stammend, ist sie heute die am meisten produzierte Textilfaser weltweit. Jährlich werden rund 25 Millionen Tonnen Baumwolle geerntet, hauptsächlich in China, Indien und den USA. Auch in Europa gibt es Anbaugebiete wie Griechenland und Spanien.
Die Baumwollpflanze ist jedoch sehr anspruchsvoll. Sie verträgt weder Frost noch viel Regen und wird daher meist in trockenen Regionen angebaut, wo sie extrem viel Wasser benötigt. Diese Anbaupraxis führt dazu, dass wertvolles Trinkwasser für die Bewässerung verwendet wird, Flüsse und Seen austrocknen (ein trauriges Beispiel ist der Aralsee) und die Böden versalzen.
Ein weiteres Problem ist der massive Einsatz von Pestiziden und Insektiziden im konventionellen Anbau, da die Pflanze sehr anfällig für Schädlinge ist. In ärmeren Anbauländern fehlt es oft an Schutzausrüstung für die Bauern, was zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen und Todesfällen führt. Die Pestizidrückstände gelangen zudem in das Grundwasser und in die Nahrungskette.
Zusätzlich werden etwa 70 % des weltweiten Baumwollanbaus mit genmanipuliertem (GMO) Saatgut betrieben. Obwohl dieses widerstandsfähiger gegen Insekten ist, benötigt es noch mehr Wasser. Das teure Saatgut und die Abhängigkeit von Agrarkonzernen treiben viele Bauern in die Verschuldung, was in einigen Regionen, besonders in Indien, zu einer erschreckend hohen Selbstmordrate führt.
Eigenschaften von Baumwolle
Baumwolle ist aus guten Gründen so beliebt: Sie ist sehr saugfähig, widerstandsfähig und äußerst hautfreundlich. Sie kann bis zu 32 % ihres Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und ist laugenbeständig. Ein Nachteil ist jedoch ihre geringe Elastizität, die dazu führt, dass sie leicht knittert. Zudem ist sie leicht entflammbar.
Weitere Fakten
Ein einziges T-Shirt aus konventioneller Baumwolle verbraucht bis zu 2.700 Liter Wasser und verursacht 5-7 kg CO2-Ausstoß.
In asiatischen Anbaugebieten wird Baumwolle oft noch von Hand gepflückt.
Inklusive der Textilherstellung arbeiten schätzungsweise 90 Millionen Kinder in der Baumwollindustrie.
Nach der Ernte folgen weitere chemische Prozesse bei der Weiterverarbeitung und dem Färben der Fasern.
Bio-Baumwolle: Die nachhaltigere Wahl
Bio-Baumwolle macht nur etwa 3,2 % des weltweiten Baumwollanbaus aus. Die Hauptproduzenten sind Indien und die Türkei, wo der ökologische Anbau eine lange Tradition hat.
Der entscheidende Unterschied liegt im Anbau:
Verbot von Pestiziden und Insektiziden: Der Anbau von Bio-Baumwolle verzichtet vollständig auf diese schädlichen Chemikalien, was sowohl der Umwelt als auch der Gesundheit der Bauern zugutekommt.
Kein genmanipuliertes Saatgut (GMO): Bio-Bauern verwenden nur nicht-modifiziertes Saatgut.
Weniger Wasserverbrauch: Die Pflanzen wachsen mehrjährig und benötigen bis zu 40 % weniger Wasser als konventionelle Baumwolle.
Fruchtfolge: Die Felder werden abwechselnd mit anderen Nutzpflanzen bestellt, was die Biodiversität fördert und zur Ernährung der lokalen Bevölkerung beiträgt.
Obwohl Bio-Baumwolle in der Weiterverarbeitung ebenfalls Chemikalien benötigt, sind die Vorgaben bei zertifizierten Produkten (z.B. GOTS) deutlich strenger. Der höhere Weltmarktpreis und die eingesparten Kosten für Pestizide ermöglichen es den Bauern, ein besseres Einkommen zu erzielen und weniger gesundheitlichen Risiken ausgesetzt zu sein.
Beim Kauf von Bio-Baumwolle ist es wichtig, auf Zertifizierungen wie GOTS oder FairTrade zu achten, da das Wort "Bio" allein nicht immer faire Arbeitsbedingungen oder einen geringen Chemikalieneinsatz in der Verarbeitung garantiert. Viele Unternehmen nutzen den Begriff für Greenwashing, ohne dass ihre gesamte Lieferkette transparent oder nachhaltig ist.
Pflanzenfasern:
Die Basis der Natur
© @cmalquist für unsplash
Hanf: Ein nachhaltiger Alleskönner
Hanf ist eine der nachhaltigsten Fasern überhaupt. Als Bastfaser aus der Hanfpflanze (Cannabis Sativa) wird sie seit Jahrtausenden für Textilien genutzt.
Was Hanf so besonders macht:
Anbau: Er wächst fast überall und benötigt nur sehr wenig Wasser.
Schädlingsresistenz: Die Pflanze ist von Natur aus robust und benötigt keine Pestizide.
Bodennährstoff: Hanf verbessert sogar die Qualität des Bodens, auf dem er wächst.
Vielseitigkeit: Die gesamte Pflanze kann genutzt werden, von den Fasern bis zu den Samen und Blättern, was Hanf zu einem echten Allrounder macht.
Hanftextilien sind extrem langlebig und widerstandsfähig. Der Stoff wird mit jedem Waschen weicher, ohne seine Robustheit zu verlieren.
Leinen: Die kühlende Faser
Leinen, gewonnen aus der Flachspflanze (LI), ist ein weiteres ökologisches Wunder. Ähnlich wie Hanf ist Leinen von Natur aus sehr ressourcenschonend.
Anbau: Flachs benötigt nur minimal Wasser und kann sogar auf nährstoffarmem Boden wachsen.
Nachhaltigkeit: Es sind kaum Pestizide notwendig und die gesamte Pflanze kann verwertet werden. In ungefärbtem Zustand ist Leinen zudem zu 100 % biologisch abbaubar.
Eigenschaften von Leinen
Leinenfasern sind glatt und schießen kaum Luft ein, was sie flusenfrei und von Natur aus bakterizid macht. Sie wirken kühlend, da sie bis zu 35 % Feuchtigkeit aufnehmen und diese schnell an die Umgebung abgeben. Gleichzeitig sind sie aber auch sehr langlebig und reißfest, was sie zu einem idealen Material für Kleidung, Bettwäsche und Heimtextilien macht.
Ein typisches Merkmal von Leinen ist seine Knitteranfälligkeit – ein Zeichen seiner geringen Elastizität, das dem Stoff jedoch seinen charakteristischen, edlen Look verleiht. Beim Bügeln sollte man darauf achten, das Material noch leicht feucht zu halten, da trockene Hitze die Fasern schädigen kann.
Insgesamt sind sowohl Hanf als auch Leinen hervorragende Beispiele für umweltfreundliche Naturfasern.
© @aki_ für unsplash
Tierische Textilfasern
Neben den Fasern aus der Pflanzenwelt gibt es auch eine Vielzahl an Textilfasern tierischen Ursprungs. Sie werden in drei Hauptkategorien unterteilt:
Wolle und feines Haar: Fasern, die vom Fell von Tieren wie Schafen, Ziegen, Alpakas oder Kamelen gewonnen werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wärmeisolierung und weiche Haptik aus.
Grobes Haar: Diese Fasern, zum Beispiel von Pferden oder Schweinen, sind deutlich fester und werden eher für Bürsten, Matratzenfüllungen oder technische Textilien verwendet.
Seide: Die einzige tierische Endlosfaser, die aus den Kokons der Seidenraupe gewonnen wird. Seide ist bekannt für ihren einzigartigen Glanz, ihre Weichheit und ihre hohe Reißfestigkeit.
Wolle: Ein Urgestein der Textilwelt
Wolle ist eine der ältesten Fasern, aus denen Menschen Textilien herstellen. Bis heute ist sie dank ihrer vielseitigen positiven Eigenschaften ein sehr hochwertiges und beliebtes Material, obwohl sie nur etwa 1 % der weltweiten Textilfaserproduktion ausmacht (ca. 2 Millionen Tonnen pro Jahr).
Schurwolle ist dabei der bekannteste Begriff und beschreibt Wolle, die durch die Schur von lebenden Schafen und Ziegen gewonnen wird. Dies unterscheidet sie von:
Reißwolle: Wiederverwertete Wolle aus Altkleidung und Textilresten.
Gerberwolle: Wolle, die von geschlachteten Tieren stammt.
Sterblingswolle: Wolle, die von natürlich verstorbenen Tieren gewonnen wird.
Der Begriff "Schurwolle" sagt noch nichts über die Tierart aus. Der Großteil der Wolle stammt jedoch vom Merinoschaf. Ursprünglich aus den nordafrikanischen Hochebenen stammend, zählen Merinoschafe heute zu den ältesten und widerstandsfähigsten Schafrassen der Welt. Ihr Fell besteht aus besonders feinen, weichen und stark gekräuselten Haaren. Das ist auch der Grund, warum Merinowolle nicht kratzig auf der Haut ist und so beliebt ist.
Schattenseiten der Wollproduktion
Trotz ihrer vielen positiven Eigenschaften hat die Wollgewinnung ihre Schattenseiten. Insbesondere in der Massenproduktion kommt es oft zu Misshandlungen der Tiere bei der Haltung und Schur. Ein besonders umstrittener und brutaler Prozess ist das sogenannte Mulesing, bei dem den Schafen ohne Betäubung die Haut um den Schwanz entfernt wird. Das soll einen Befall von Fliegenmaden verhindern, fügt den Tieren aber große Schmerzen zu.
Ein weiteres Problem ist der enorme Landverbrauch. Um eine Tonne Rohfaser zu produzieren, werden rund 67 Hektar Land benötigt. Bei steigender Nachfrage, beispielsweise nach Kaschmirwolle, führt dies zu Massentierhaltung, die nicht nur den Tieren schadet, sondern auch das Ökosystem mit seiner vielfältigen Flora und Fauna beeinträchtigt.
Was tun?
Achte auf die Herkunft und Haltung der Schafe. Ein guter Anhaltspunkt sind Zertifizierungen wie das RWS-Siegel (Responsible Wool Standard), das artgerechte Haltung und faire Arbeitsbedingungen sicherstellt.
Positive Eigenschaften von Wolle
Wärmeisolierend und atmungsaktiv: Sie wärmt bei Kälte (sogar im nassen Zustand) und kühlt bei Wärme.
Natürlich wasser- und schmutzabweisend.
Selbstreinigend und geruchsneutral: Oft genügt Auslüften anstatt Waschen.
Antistatisch: Lädt sich nicht elektrostatisch auf.
Schwer entflammbar.
Knittert kaum.
Sehr langlebig.
Biologisch abbaubar.
Fakten rund um Wolle
Ein Schaf liefert ca. 2-4 kg Wolle pro Jahr.
Merinoschafe werden gezielt so gezüchtet, dass ihre Haut faltiger ist, um mehr Wolle zu produzieren.
Australien ist mit 88 % (Stand 2018) der größte Produzent von Merinowolle weltweit.
Die Schafzucht trägt durch Methangas zu Treibhausgasemissionen bei.
Oft werden umweltschädliche Pestizide im Tierbestand eingesetzt, um Schädlinge zu bekämpfen.
© @yoonbae81 für unsplash
Seide: Ein Hauch von Luxus
Seide ist die einzige tierische Endlosfaser und wird aus dem Kokon der Seidenraupe (meist der Maulbeerspinner) gewonnen. Ihre einzigartige Haptik, der natürliche Glanz und die hohe Reißfestigkeit machen Seide zu einem der wertvollsten Naturmaterialien der Welt.
Der Herstellungsprozess ist jedoch umstritten. Für die gängige Seidenproduktion werden die Kokons der Seidenraupen in kochendes Wasser getaucht, um die langen Seidenfäden abwickeln zu können – dabei stirbt die Raupe. Dies hat zu einer Nachfrage nach tierleidfreien Alternativen geführt, wie zum Beispiel Wildseide oder Peace Silk, bei der die Schmetterlinge den Kokon auf natürliche Weise verlassen können. Allerdings ist die Qualität dieser Seide oft geringer, da der Faden durch den Austritt unterbrochen wird.
Trotzdem bleibt Seide ein Material mit herausragenden Eigenschaften:
Glänzend & weich: Der natürliche Glanz und die glatte Oberfläche verleihen einen luxuriösen Look.
Temperaturregulierend: Seide kühlt bei Hitze und wärmt bei Kälte.
Hautfreundlich: Sie ist hypoallergen und für empfindliche Haut geeignet.
Feuchtigkeitsausgleichend: Seide kann bis zu 30 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen.
In der Textilbranche ist Seide nach wie vor ein Symbol für Eleganz, auch wenn ihre Produktion ethische Fragen aufwirft.
Chemiefasern aus synthetischen Polymeren (Erdölbasis)
Wir verlassen nun die Welt der Naturfasern und tauchen ein in die Materie, die vollständig im Labor entstanden ist: die synthetischen Chemiefasern. Diese Fasern – zu denen Materialien wie Polyamid (Nylon) und Elastan gehören – basieren auf künstlich hergestellten Polymeren, deren Rohstoff fast immer Erdöl (Rohöl) ist.
Im Gegensatz zu Naturfasern, die von Klima und Ernteerträgen abhängig sind, können diese Fasern in unbegrenzter Menge industriell hergestellt werden. Diese chemische Flexibilität macht sie extrem vielseitig: sie können in nahezu jede Form gebracht werden, sind reißfest, pflegeleicht und oft sehr günstig in der Produktion. Sie bilden damit das Rückgrat der modernen Textilindustrie.
Doch diese Unabhängigkeit von der Natur hat ihren Preis. Der gesamte Herstellungsprozess ist energieintensiv, verbraucht fossile Ressourcen und stellt uns vor immense ökologische Herausforderungen – allen voran das Problem der Mikroplastik-Belastung und der mangelnden biologischen Abbaubarkeit.
Polyester (PES) & Verwandte Fasern
Polyester ist im Grunde genommen nur dünn gesponnener Plastik. Obwohl es erst seit 1951 kommerziell produziert wird, hat es Baumwolle als meistgenutzte Faser längst überholt. Heute stecken in über 60 % aller Kleidungsstücke Polyesterfasern. Die weltweite Produktion ist in den letzten Jahrzehnten exponentiell gestiegen. Das liegt daran, dass die Herstellung deutlich billiger ist als die von Naturfasern, da man keine landwirtschaftlichen Flächen braucht und nicht auf gute Ernten angewiesen ist.
Doch dieser Komfort hat einen hohen Preis.
Hoher Energieverbrauch: Die Produktion von Polyesterfasern aus Erdöl erfordert extreme Hitze (bis zu 270 °C), was einen massiven Energieverbrauch nach sich zieht. Dabei wird auch eine große Menge an CO2 freigesetzt, was den Klimawandel weiter vorantreibt.
Keine biologische Abbaubarkeit: Ein T-Shirt aus Polyester braucht bis zu 500 Jahre, um sich in der Natur zu zersetzen. Dabei setzen sich die verwendeten Chemikalien wieder frei, sickern in den Boden und gelangen ins Grundwasser. Das ist angesichts der Berge von weggeworfener Kleidung ein riesiges Desaster.
Mikroplastik: Bei jedem Waschgang gibt ein einziges Kleidungsstück aus Polyester bis zu 1.900 Mikroplastikfasern ab. Diese sind so klein, dass sie die Filtersysteme der Kläranlagen umgehen und direkt in unsere Flüsse, Seen und Ozeane gelangen – und damit in die Nahrungskette.
Eigenschaften & Nutzen
Polyester fühlt sich leicht an, knittert kaum, trocknet schnell und ist sehr langlebig. Durch die chemische Herstellung können den Fasern gezielt unterschiedliche Eigenschaften gegeben werden. So ist es möglich, ein Material zu erschaffen, das die Optik und Haptik von Naturfasern imitiert. Ein "Wollpullover" aus Polyester ist dafür ein gutes Beispiel.
Viele Menschen verknüpfen den schimmernden Stoff Satin fälschlicherweise mit Seide. Aber Satin ist keine Faser, sondern eine spezielle Webart, die für ihren Glanz sorgt. Diese Webart kann sowohl mit Baumwolle als auch mit synthetischen Fasern wie Polyester hergestellt werden. Die chemische Flexibilität von Polyester macht es ideal für Funktionskleidung, da es Schweiß ableiten oder isolierend wirken kann.
Recyceltes Polyester (rPET): Ein Hoffnungsschimmer?
Recyceltes Polyester (rPET) wird als die umweltfreundlichere Alternative gehandelt, und das aus gutem Grund: Für seine Produktion muss kein neues Erdöl verbraucht werden, stattdessen werden vorhandene Abfälle wiederverwertet. Das spart Ressourcen und Energie.
Die Recyclingquote von Kunststoffen hat sich stark verbessert, aber es gibt weiterhin große Hürden:
Hohe Energiekosten: Auch der Recyclingprozess selbst verbraucht viel Energie.
Mikroplastik bleibt ein Problem: Recyceltes Polyester gibt ebenfalls Mikroplastik in das Abwasser ab.
Downcycling: Nicht jedes Plastik ist recycelbar. Oft wird Material "downgecycelt", was bedeutet, dass die Qualität mit jedem Recycling-Prozess sinkt und der Stoff am Ende nur noch als Brennstoff dienen kann.
Mangelnde Transparenz: Das rPET in Kleidung besteht nur selten aus alten Textilien, sondern meist aus recycelten PET-Flaschen.
Achtung, Greenwashing!
Viele Unternehmen nutzen das Image von Recycling – insbesondere aus Meeresplastik – für ihr grünes Image. Es ist wichtig, genau hinzusehen, denn oft ist der Recycling-Anteil im Produkt nur minimal, und die gesamte Lieferkette ist nicht transparent.
© @worldsbetweenlines für unsplash
© @ Naja Bertolt Jensen für unsplash
© @mihaiteslariu0 für unsplash
Zellulosefasern: Die "natürlichen" Chemiefasern
Neben den Fasern aus Erdöl gibt es eine weitere Kategorie von Chemiefasern, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren: die Zellulosefasern. Materialien wie Viskose, Modal und Lyocell werden aus Zellulose hergestellt, die aus Holz oder Baumwolle gewonnen wird. Dies macht sie potenziell nachhaltiger als Kunststoffe, da ihre Basis biologischen Ursprungs ist.
Chemiefasern können in zwei Kategorien eingeteilt werden:
Fasern aus natürlichen Polymeren: Diese basieren auf Zellulose, Proteinen oder Milchsäure – wie Viskose und Lyocell.
Fasern aus synthetischen Polymeren: Diese werden nur im Labor hergestellt – wie Polyester und Elastan.
Die Herstellung von Zellulosefasern ist ein chemischer Prozess. Die Zellulose wird zunächst aus dem Rohstoff (z. B. Holz) herausgelöst und anschließend mit Chemikalien verarbeitet, um eine spinnbare Flüssigkeit zu erzeugen, aus der dann Fäden entstehen. Das macht klar: Obwohl der Ursprung natürlich ist, ist die Produktion alles andere als ein reiner Naturprozess.
Viskose (CV): Ein Material mit zwei Gesichtern
Viskose ist die drittmeistgenutzte Textilfaser der Welt. Ihre Herstellung beginnt mit der Zellulose aus Holz von Buchen, Fichten oder Eukalyptus.
Der Prozess: Die Zellulose wird mit Natronlauge "herausgekocht" und anschließend mit giftigen Chemikalien wie Schwefelkohlenstoff und Schwefelsäure zu einer zähflüssigen Masse verarbeitet. Diese wird im sogenannten Nassspinnverfahren zu Fasern gesponnen.
Die Herausforderungen:
Umweltbelastung: Trotz der nachwachsenden Rohstoffe werden für die Produktion oft Wälder gerodet. Zudem belasten die giftigen Chemikalien die Umwelt und können nicht immer vollständig recycelt werden.
Ressourcen: Nur etwa 30 % eines Baumes können effektiv für die Zelluloseproduktion genutzt werden.
Lyocell: Die grüne Alternative
Lyocell, oft unter dem Markennamen TENCEL™ bekannt, wird ebenfalls aus Zellulose hergestellt. Doch hier gibt es einen entscheidenden Unterschied im Herstellungsprozess. Anstelle der giftigen Chemikalien wird ein ungiftiges Lösungsmittel namens N-Methylmorpholin-N-oxid (NMMO) verwendet.
Der Vorteil des Lyocell-Verfahrens:
Geschlossener Kreislauf: Das Lösungsmittel wird zu über 99 % aufgefangen und wiederverwendet. Das reduziert Abfall und die Umweltbelastung massiv.
Nachhaltige Rohstoffe: Das Holz stammt zu mehr als 99 % aus nachhaltig bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern (FSC, PEFC). Im Gegensatz zu Baumwolle benötigen diese Bäume keine künstliche Bewässerung.
Wasserverbrauch: Die Produktion von Lyocell verbraucht laut Herstellerangaben nur ein Drittel des Wassers, das für Viskose benötigt wird.
Vergleich der Eigenschaften:
Beide Fasern sind hautfreundlich, atmungsaktiv und haben eine gute Feuchtigkeitsaufnahme. Lyocell ist jedoch im Allgemeinen widerstandsfähiger und scheuerbeständiger als Viskose. Ein reines Lyocell-Kleidungsstück ist zudem vom Hersteller als biologisch abbaubar zertifiziert, was bei Viskose aufgrund der Herstellungschemikalien nicht der Fall ist.
Leder: Ein Material mit langer Geschichte und vielen Schattenseiten
Auch wenn Leder keine Faser ist, darf es in einer Übersicht über Textilmaterialien nicht fehlen. Es entsteht durch einen langwierigen Gerbungsprozess, bei dem die verderbliche Haut von Tieren in ein haltbares und langlebiges Material umgewandelt wird.
Dieser Prozess, der in Gerbereien stattfindet, kann je nach Art und gewünschten Eigenschaften des Leders bis zu 55 Schritte umfassen. Dabei werden unterschiedliche Gerbstoffe eingesetzt:
Pflanzliche Gerbung: Es werden Gerbstoffe aus Holz oder Rinden verwendet.
Mineralische Gerbung: Hier kommen Chromsalze, Aluminiumsalze oder Zirkonsalze zum Einsatz. Diese sind besonders in der Massenproduktion verbreitet.
Synthetische Gerbung: Es werden synthetisch hergestellte Stoffe wie Aldehyde verwendet.
Gerade die weit verbreitete Chromgerbung ist problematisch. Sie führt zu giftigen Abfallprodukten, die die Umwelt massiv belasten. Auch im Leder selbst können krebserregende Rückstände verbleiben, die nicht nur für die Träger, sondern vor allem für die Arbeiter in den Gerbereien eine große Gefahr darstellen.
Neben der Gerbung hat die Lederproduktion weitere negative Auswirkungen:
Massiver Wasserverbrauch: Für die Aufzucht der Tiere und den Gerbprozess werden enorme Mengen Wasser benötigt – bis zu 17.000 Liter für 1 kg Leder.
Landverbrauch: Die Tierhaltung beansprucht große Weideflächen, was zur Abholzung von Wäldern, Überdüngung und Bodenerosionen führt.
Umweltzerstörung: Der Einsatz von Futtermitteln und Medikamenten sowie die Zerstörung natürlicher Ökosysteme tragen zur Wasser- und Nahrungsknappheit in den Produktionsländern bei.
Vegane Lederalternativen: Der Schein trügt
Die steigende Nachfrage nach veganen Lederalternativen ist grundsätzlich eine gute Entwicklung, doch tierfrei bedeutet nicht automatisch ökologisch. Viele Unternehmen werben mit "veganem Leder", meinen damit aber oft nichts anderes als synthetische Chemiefasern auf Erdölbasis wie Polyurethan (PU) oder Polyvinylchlorid (PVC). Es ist wichtig, hier genau hinzusehen und sich nicht durch das Wort "vegan" in die Irre führen zu lassen.
Innovative pflanzliche Alternativen
Zum Glück gibt es inzwischen echte Innovationen, die auf pflanzlicher Basis hergestellt werden. Die Anzahl der Alternativen aus Abfallprodukten der Lebensmittelindustrie wächst stetig, darunter:
Ananasleder (Piñatex®)
Pilzleder
Kaktusleder
Obwohl auch hier teilweise noch synthetische Zusatzstoffe für die Haltbarkeit verwendet werden, schreiten die Forschung und die Entwicklung biologisch abbaubarer und recyclingfähiger Materialien ständig voran.
Eigenschaften von Leder
Die Eigenschaften von Leder sind sehr vielseitig und hängen stark von der Gerbung ab. Es kann robust, langlebig, atmungsaktiv und wärmend sein, aber auch geschmeidig, flexibel und elastisch. Leder ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das Schutz bietet und je nach Bearbeitung sehr unterschiedliche Texturen annehmen kann.
© @aaaarupar für unsplash
© @etiennegirardet für unsplash
Die Vielfalt an veganen Lederalternativen wächst stetig, aber all diese innovativen Materialien – von Piñatex® aus Ananasblättern über Desserto® aus Kaktusfasern bis hin zu Weinleder – haben eine entscheidende Gemeinsamkeit: Sie werden aus pflanzlichen Abfällen oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Gemeinsamkeiten im Herstellungsprozess
Der Prozess beginnt oft mit der Ernte oder Sammlung von landwirtschaftlichen Restprodukten, die andernfalls entsorgt oder verbrannt würden. Diese Abfallprodukte werden dann gereinigt, getrocknet und zu einer feinen Masse verarbeitet. In einem weiteren Schritt wird diese Masse mit einem Bindemittel zu einem festen Vlies oder einem lederähnlichen Material geformt. Anschließend folgen Veredelungsschritte wie Färben, Beschichten und Prägen, um das Material wasserabweisend, widerstandsfähig und optisch ansprechend zu machen. Ein wesentlicher Unterschied zu tierischem Leder ist, dass der komplexe und umweltbelastende Gerbprozess entfällt.
Ökologische Relevanz
Die ökologische Relevanz dieser Materialien ist enorm. Sie tragen zur Kreislaufwirtschaft bei, indem sie landwirtschaftliche Abfälle aufwerten und ihnen ein neues Leben geben. Dadurch wird der enorme Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung, die mit der Tierhaltung und der traditionellen Lederproduktion einhergehen, vermieden. Diese Alternativen verbrauchen deutlich weniger Wasser, Land und Energie und verursachen weniger Treibhausgasemissionen. Sie sind ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltigerer Mode- und Konsumgüter.
Insgesamt bieten diese Materialien nicht nur eine tierleidfreie Alternative, sondern auch eine innovative Lösung für einige der dringendsten Umweltprobleme unserer Zeit.
Innovative Materialien –
Vegane & nicht-synthetische Lederalternativen
© @nely_snork für unsplash
1. Ananasfasern (Piñatex®)
Piñatex® wird aus den Fasern der Ananasblatt-Reste hergestellt, die bei der Ernte sonst auf den Feldern verrotten würden. Die Fasern werden entgummiert und zu einem Vlies verarbeitet, das dann mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen wird. Das Material ist atmungsaktiv und flexibel, wird oft für Schuhe, Taschen und Accessoires verwendet.
2. Bananenfasern
Ähnlich wie bei der Ananas werden die Fasern aus den Stämmen der Bananenpflanze gewonnen, die nach der Ernte abgeschnitten und entsorgt werden müssen. Bananenfasern sind extrem robust und widerstandsfähig, was sie ideal für die Herstellung von Seilen, Netzen und groben Stoffen macht. Für feinere Textilien und Lederalternativen wird die Faser zu Garn gesponnen oder zu einem Vlies verarbeitet.
3. Pilz/Myzel (Muskin™, Mylo™)
Diese Lederalternative wird aus dem Myzel, dem Wurzelgeflecht von Pilzen, gezüchtet. Das Myzel wächst in nur wenigen Wochen in großen Platten, die dann gegerbt und zu einem lederähnlichen Material verarbeitet werden. Das Ergebnis ist ein weiches, geschmeidiges und biologisch abbaubares Material, das dem Aussehen und der Haptik von Tierleder sehr nahe kommt.
4. Kombucha
Aus der Fermentation von gesüßtem Tee mit einem SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) entsteht eine dicke, gelartige Matte aus Zellulose. Diese Matte kann getrocknet und bearbeitet werden, um ein lederartiges Material zu erhalten. Es ist jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium, da es sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert und bei der Verarbeitung leicht reißt.
5. Kork
Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Ernte schädigt den Baum nicht, da die Rinde nachwächst. Korkleder wird durch die Verarbeitung dünner Korkschichten zu einem weichen, flexiblen und wasserabweisenden Material hergestellt. Es ist von Natur aus leicht, robust und hat eine einzigartige, natürliche Textur.
© @marinareich für unsplash
6. Teakblätter
Diese Lederalternative wird aus großen, gefallenen Teakblättern hergestellt. Die Blätter werden getrocknet, gefärbt und anschließend zu einem flexiblen, lederähnlichen Material laminiert. Es ist ein sehr nachhaltiges Material, da es die natürlichen Abfälle der Teak-Wälder nutzt. Das resultierende Produkt hat eine rustikale, natürliche Optik.
7. Apfelfasern (AppleSkin™)
AppleSkin™ wird aus den Abfällen der Apfelsaft- und Apfelmusproduktion hergestellt. Die Apfeltrester (Schalen und Kerne) werden getrocknet, gemahlen und mit einer Trägerbasis vermischt, um ein lederartiges Material zu formen. Es ist ein sehr weiches und geschmeidiges Material, das häufig für Handtaschen und Schuhe verwendet wird.
8. Kaktusfaser (Desserto®)
Desserto® ist ein lederartiges Material, das aus den Blättern der Nopal-Kakteen hergestellt wird. Die reifen Blätter werden geerntet, getrocknet und zu einem Pulver verarbeitet. Dieses Pulver wird dann zu einem lederähnlichen Stoff verarbeitet. Das Material ist atmungsaktiv, langlebig und biologisch abbaubar. Kaktusbauern benötigen nur sehr wenig Wasser, um die Pflanzen anzubauen.
9. Weinleder (Vegea™)
Vegea™ wird aus den Abfällen der Weinproduktion, den sogenannten Trester (Schalen, Stiele und Kerne der Trauben), hergestellt. Diese werden getrocknet, verarbeitet und mit Pflanzenölen zu einem Material vermischt, das optisch und haptisch echtem Leder ähnelt. Es ist eine innovative Art, landwirtschaftliche Abfälle aufzuwerten.
10. Papierleder (Washable Paper)
Papierleder ist ein robustes, waschbares Material, das aus Zellulosefasern und Latex besteht. Es kann vernäht, geformt und sogar gewaschen werden, ohne zu reißen. Es wird oft für Taschen, Etuis oder Portemonnaies verwendet und ist eine einfache, nachhaltige Alternative. Mit der Zeit bekommt es eine Patina, die es noch interessanter macht.
Biologische Abbaubarkeit und Recyclingfähigkeit im Detail
Diese Materialien sind grundsätzlich entweder biologisch abbaubar oder recyclingfähig, wobei die genaue Eigenschaft von der spezifischen Zusammensetzung und Veredelung abhängt.
Biologisch abbaubare Materialien: Viele der genannten Lederalternativen sind im Kern biologisch abbaubar, da sie aus pflanzlichen Rohstoffen wie Zellulose (Ananas-, Bananen-, Pilz-, Kaktus-, Apfel- und Weinmaterialien) bestehen. Das bedeutet, dass sie unter bestimmten Bedingungen von Mikroorganismen zersetzt werden können.
Die biologische Abbaubarkeit ist jedoch nicht bei allen Produkten garantiert, da die finalen Produkte oft mit Bindemitteln oder Beschichtungen versehen werden, die nicht biologisch abbaubar sind (z. B. auf Polyurethan-Basis).
Recyclingfähigkeit: Die Recyclingfähigkeit dieser Materialien hängt ebenfalls von ihrer Zusammensetzung ab. Materialien wie Desserto® (Kaktusleder) können mechanisch oder chemisch recycelt werden, sind aber aufgrund der Bindemittel oft nicht biologisch abbaubar. Kork ist ein hervorragendes Beispiel für ein Material, das sowohl recycelbar als auch biologisch abbaubar ist. Papierleder ist meist recycelbar, da es aus Zellulose besteht und oft wieder in den Papierkreislauf zurückgeführt werden kann.
Herausforderungen: Die größte Herausforderung bei der Entsorgung dieser Materialien liegt oft in den Mischkomponenten. Um die gewünschte Haltbarkeit und Wasserfestigkeit zu erreichen, werden den Naturfasern häufig Kunststoffe wie PU oder andere Veredelungsschichten hinzugefügt. Diese Zusätze können die biologische Abbaubarkeit behindern und das Recycling erschweren. Ein Produkt, das zu 90 % aus pflanzlichen Fasern besteht, aber mit einer 10 %igen Kunststoffschicht überzogen ist, kann nicht einfach kompostiert werden und ist oft auch schwer zu recyceln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Materialien einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit darstellen, aber die Endverwertung jedes einzelnen Produkts genau betrachtet werden muss. Es ist entscheidend, dass Hersteller transparent machen, welche Bindemittel und Beschichtungen verwendet werden, damit Konsumenten eine informierte Entscheidung treffen können.
© @pineapple für unsplash